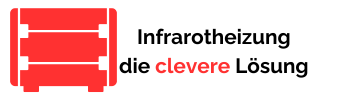Infrarotheizungen – eine alternative?
Infrarotheizungen wandeln elektrischen Strom in Wärmestrahlung um und erwärmen damit direkt Oberflächen, Gegenstände und Personen im Raum, anstatt primär die Luft zu erhitzen. Diese Funktionsweise unterscheidet sich grundlegend von konventionellen Heizsystemen wie Zentralheizungen mit Heizkörpern oder Fußbodenheizungen. Im folgenden Testbericht werden Effizienz, Kosten, gesundheitliche Aspekte und Umweltfreundlichkeit von Infrarotheizungen detailliert beleuchtet. Außerdem wird analysiert, für welche Zielgruppen und Einsatzbereiche Infrarotheizungen eine sinnvolle Alternative zu klassischen Heizungen darstellen.
Inhalt
Effizienz von Infrarotheizungen im Vergleich
Wirkungsgrad: Infrarotheizungen erreichen technisch einen Wirkungsgrad von nahezu 100 % bei der Umwandlung von Strom in Wärme – jede verbrauchte Kilowattstunde Strom wird in etwa eine Kilowattstunde Wärme. Im Gegensatz zu Gas- oder Ölheizungen entstehen keine Abgase oder Abwärmeverluste durch Schornsteine. Allerdings muss man diese Zahl relativieren: Ein Wärmepumpensystem beispielsweise nutzt Strom, um Umgebungswärme zu pumpen, und erzielt dadurch effektiv einen viel höheren Nutzwärme-Ertrag (eine moderne Wärmepumpe liefert aus 1 kWh Strom oft 3–4 kWh Wärme). Infrarotheizungen sind somit weniger energieeffizient, was den primären Energieverbrauch betrifft, als ein Wärmepumpensystem. Vergleicht man mit einer Gasheizung, liegt der Brennstoffnutzungsgrad moderner Gasthermen bei ~90 %, also etwas unter der direkten Effizienz einer Infrarotheizung – dennoch ist Gas pro kWh oft günstiger und primärenergetisch derzeit begünstigt.
Direktwärme vs. Konvektion: Ein Vorteil der Infrarot-Technik ist die direkte Wärmeabgabe an Personen und Objekte. Da nicht zuerst die Raumluft aufgeheizt wird, geht weniger Wärme durch Luftzirkulation verloren. Man verspürt Wärme schon kurz nach dem Einschalten, ähnlich wie man an einem kühlen Tag in der Sonne Wärme fühlt, selbst wenn die Luft kalt ist. Dadurch kann die wahrgenommene Behaglichkeit bereits bei etwas niedriger Lufttemperatur erreicht werden. In der Praxis bedeutet das: Mit einer Infrarotheizung kann die thermostatgesteuerte Raumlufttemperatur 2–3 °C niedriger sein als bei einer konvektiven Heizung, ohne Komforteinbußen. Dieser Effekt kann die Heizdauer und den Energieverbrauch reduzieren, da jedes Grad weniger Raumtemperatur rund 6 % Heizenergie einsparen kann. Allerdings funktioniert das nur, wenn man sich tatsächlich im Strahlungsbereich der Heizung aufhält – in Ecken oder hinter Objekten bleibt es sonst kühler.

Aufheizzeit und Wärmeverteilung: Infrarotpaneele reagieren schnell. Innerhalb von Minuten bis wenigen zehn Minuten ist die volle Strahlungsleistung erreicht (je nach Paneeltyp: Glasheizungen erwärmen sich z.B. in unter 10 Minuten, dickere Naturstein-Paneele brauchen bis zu 30 Minuten, speichern dafür aber Wärme länger). Die Wärme wird gleichmäßig im Strahlungsbereich verteilt, ohne die üblichen Temperaturunterschiede zwischen Decke und Boden, die man von Heizkörpern kennt. Kalte Zonen im Raum werden minimiert, sofern genügend Paneele strategisch platziert sind. Wichtig ist dabei, dass Möbel oder Vorhänge nicht die Strahlung blockieren – ein Mindestabstand (z.B. ~30 cm vor dem Paneel) sollte eingehalten werden, damit die Wärmewellen frei abstrahlen können. Insgesamt liefert eine korrekt dimensionierte Infrarotheizung punktgenau Wärme, was insbesondere in kleinen Räumen oder einzelnen Zonen effizient sein kann. In größeren oder verwinkelten Räumen sind dagegen oft mehrere Paneele nötig, um überall angenehme Temperaturen zu erzielen, was den Verbrauch erhöht.
Einflussfaktoren auf die Effizienz: Die tatsächliche Effizienz im Heizalltag hängt stark von äußeren Faktoren ab. Dämmung und Bausubstanz spielen die größte Rolle – in einem gut isolierten Gebäude geht weniger Wärme verloren, sodass die Infrarotheizung weniger häufig nachheizen muss. In einem schlecht gedämmten Altbau hingegen strahlen die Paneele zwar Wände und Personen an, aber die Wände kühlen nach außen rasch aus, wodurch kontinuierlich nachgeheizt werden muss. Auch die Raumgröße und Deckenhöhe beeinflussen die Effizienz: Hohe Decken oder große offene Grundrisse erfordern mehr Leistung, denn die Strahlungsreichweite eines Standard-Paneels liegt typischerweise bei 3–4 Metern. Weiterhin spielt das Nutzerverhalten eine Rolle – Infrarotheizungen eignen sich gut für zeitweise Beheizung. Wenn man z.B. Räume nur bei Bedarf heizt (etwa ein Arbeitszimmer tagsüber, Wohnzimmer abends), kann eine Infrarotheizung effizienter sein als eine Zentralheizung, die vielleicht das ganze Haus auf Temperatur hält. Wird jedoch dauerhaft eine konstante Temperatur in allen Räumen gehalten, gibt es energetisch kaum einen Vorteil gegenüber herkömmlichen Heizkörpern (dann zählt hauptsächlich der Strompreis-Nachteil, siehe unten). Insgesamt sind Infrarotheizungen effizient für zoniertes, kurzzeitiges Heizen und in Gebäuden mit geringem Wärmebedarf – während für das Rund-um-die-Uhr-Beheizen größerer oder schlecht gedämmter Flächen andere Systeme effizienter sind.
Kosten: Anschaffung, Betrieb und Wartung
Anschaffungskosten: Infrarotheizungen sind in der Regel deutlich günstiger in der Anschaffung als Zentralheizungen. Einfache Infrarot-Heizpaneele bekommt man bereits ab rund 100 € (kleine 200–300 W Paneele). Größere oder dekorative Modelle (z.B. Glasfront, Spiegelheizung, Bildmotiv) kosten je nach Leistung und Design etwa 300–600 € pro Stück. Für die Beheizung eines ganzen Einfamilienhauses oder einer geräumigen Wohnung werden entsprechend mehrere Paneele benötigt – dennoch sind die Gesamtkosten meist niedriger als die Installation einer Gasheizung oder Wärmepumpe. Zum Vergleich: Eine neue Gas-Brennwertheizung inkl. Heizkörpern und Rohrleitungsinstallation kann leicht fünfstellig (10.000 € und mehr) kosten, und Wärmepumpensysteme liegen oft noch höher. Infrarotheizungen benötigen keine aufwändige Installation: Es entfallen Kosten für Rohrleitungen, Schornstein, Tank oder Wärmepumpen-Bohrungen. Die Paneele werden einfach an Wand oder Decke montiert und an das Stromnetz angeschlossen (häufig genügt sogar eine normale Steckdose). Dadurch entstehen auch bei Nachrüstung kaum Installationskosten – ein wichtiger Vorteil, z.B. in Bestandsgebäuden ohne Zentralheizung.
Betriebskosten: Dem günstigen Kaufpreis stehen allerdings höhere Betriebskosten gegenüber. Eine Infrarotheizung verbraucht Strom, und Strom ist pro kWh teurer als Gas, Öl oder Pellets. Um die Betriebskosten abzuschätzen, betrachtet man den Heizwärmebedarf: Pro Quadratmeter Wohnfläche werden je nach Dämmstandard etwa 60–100 W Heizleistung benötigt, um einen Raum auf ca. 20 °C zu bringen. Für eine Wohnung von 20 m² heißt das grob 1.200–2.000 W an IR-Leistung. Läuft diese Heizung eine Stunde lang, werden 1,2–2 kWh Strom verbraucht. Bei einem Strompreis von 30 Cent/kWh kostet diese eine Stunde Heizen rund 0,36–0,60 €. Hochgerechnet auf einen ganzen Tag oder Wintermonat ergeben sich spürbare Beträge. Eine Beispielrechnung: Eine 100 m² große, durchschnittlich gedämmte Wohnung benötigt etwa 8 kW an Infrarotheizungen, um im Winter komplett beheizt zu werden. Angenommen, die Heizung läuft an kalten Tagen etwa 8 Stunden pro Tag, ergibt das um die 11.000–12.000 kWh Stromverbrauch im Jahr. Bei ~0,30 €/kWh sind das rund 3.300–3.600 € Heizstromkosten pro Jahr. Zum Vergleich würde eine moderne Luft-Wärmepumpe für dieselbe Heizlast nur ca. 4.000 kWh Strom benötigen (dank hoher Effizienz), was etwa 1.200 € jährlich entspricht. Auch Gasheizungen wären bei diesen Energiebedarfen meist günstiger, je nach Gaspreis (bei 10 Cent/kWh Gas wären 12.000 kWh etwa 1.200 € plus Grundgebühren). Diese Differenz zeigt: Vollständiges Beheizen größerer Flächen mit Infrarot kann teuer sein. Entscheidend sind jedoch die individuellen Umstände: In gut gedämmten Niedrigenergiehäusern fällt der Heizwärmebedarf viel niedriger aus – hier kann eine Infrarotheizung durchaus wirtschaftlich betrieben werden, vor allem wenn nur selektiv geheizt wird. In schlecht isolierten Altbauten hingegen wären die Stromkosten enorm. Ebenso gilt: Wer nur einzelne Räume oder kurze Zeit heizt (z.B. abends Bad und Wohnzimmer), hat deutlich geringere Betriebsaufwendungen als jemand, der ganztägig alle Räume beheizt.
Tarife und Strompreisabhängigkeit: Es gibt spezielle Heizstrom- oder Nachtstromtarife, die günstiger sein können als der normale Haushaltsstrom. Allerdings werden solche Tarife meist für fest installierte Nachtspeicheröfen angeboten und erfordern getrennte Zählerkreise. Infrarotpaneele, die einfach am normalen Stromkreis hängen, laufen zum üblichen Arbeitspreis. Zudem unterliegen Strompreise Schwankungen und tendenziell steigenden Abgaben – Nutzer von Infrarotheizungen sind dieser Entwicklung direkt ausgesetzt (Abhängigkeit von Strompreisen). Es gibt derzeit kaum staatliche Förderung für rein elektrische Direktheizungen, sodass man auf Einsparmöglichkeiten wie eigene Photovoltaikanlagen setzen muss, um Kosten zu senken (mehr dazu unter Umweltfreundlichkeit).
Wartungskosten: Hier punkten Infrarotheizungen deutlich. Die Technik ist simpel – im Grunde ein elektrischer Heizleiter in einer Platte – sodass kaum Verschleißteile vorhanden sind. Es müssen keine Filter getauscht, kein Brenner gewartet und kein Schornstein gereinigt werden. Während bei einer Gasheizung jährlich Wartungsarbeiten und alle paar Jahre Schornsteinfeger-Kontrollen anfallen (mit entsprechenden Kosten), entfallen solche Posten bei Infrarotheizungen komplett. Die Geräte haben typischerweise eine lange Lebensdauer (viele Hersteller wie Vasner oder Knebel geben 20 Jahre und mehr an) ohne nennenswerten Effizienzverlust über die Zeit. Die laufenden Kosten beschränken sich also auf den Strom.
Zusammengefasst: Infrarotheizungen sind anschaffungsgünstig und wartungsarm, verursachen aber je nach Nutzung deutlich höhere Betriebskosten als zentrale Heizsysteme mit günstigeren Energieträgern. Sie lohnen sich wirtschaftlich vor allem in Szenarien mit geringem oder sporadischem Heizbedarf, oder wenn durch Eigenstrom (PV-Anlage) die Stromkosten reduziert werden können.

Gesundheitliche Aspekte und Raumklima
Wohlbefinden durch Strahlungswärme: Infrarotheizungen erzeugen eine Wärme, die viele Menschen als sehr angenehm empfinden – vergleichbar mit Sonnenstrahlen auf der Haut. Da Wände, Böden und Möbel direkt erwärmt werden, sind die Oberflächen im Raum tendenziell wärmer als bei Luftheizungen. Das verhindert das Gefühl von „kalten Wänden“ oder Fußböden; man kann sich beispielsweise an eine Wand lehnen, ohne Kälte zu spüren. Dieses gleichmäßige Temperaturfeld trägt zu einem behaglichen Wohnklima bei und reduziert klamme Feuchtigkeit an Wänden. Einige Nutzer berichten auch von einer tieferen Entspannung der Muskulatur durch die sanfte IR-Strahlung – ähnlich dem Prinzip von Infrarot-Wärmekabinen, wenn auch wesentlich schwächer. Insgesamt führt die Strahlungsheizung zu einer anderen Wärmeempfindung: Man fühlt sich bei niedrigeren Lufttemperaturen bereits warm, weil der Körper direkt gewärmt wird.
Keine Staubaufwirbelung: Ein großer Pluspunkt ist, dass keine starke Luftzirkulation entsteht. Herkömmliche Heizkörper erwärmen Luft, welche aufsteigt und im Raum zirkuliert. Diese Luftbewegung wirbelt Staub auf und verteilt ihn – schlecht für Allergiker und auch ungünstig für die Atemwege bei empfindlichen Personen. Infrarotheizungen hingegen erwärmen vor allem feste Körper; die Luft wird indirekt und viel gleichmäßiger erwärmt (vor allem durch Abgabe der Wärme von den Wänden und Gegenständen an die Luft). Dadurch gibt es kaum Konvektionsströme. Das Raumklima bleibt ruhiger, Staub bleibt eher am Boden, und die Hausstaubbelastung kann sinken. Allergiker und Asthmatiker profitieren von dieser staubarmen Wärmequelle. Zudem trocknet die Luft nicht stärker aus als bei anderen Heizungen – im Gegenteil kann die relative Luftfeuchtigkeit etwas höher bleiben, weil nicht massiv heiße Luft die Feuchtigkeit bindet. Menschen empfinden dies oft als angenehmer und weniger reizend für Schleimhäute.
Schimmelvorbeugung: Durch das Erwärmen der Wände und Ecken kann einer Schimmelbildung im Raum vorgebeugt werden. Normalerweise bildet sich Schimmel bevorzugt an kalten, feuchten Wandstellen, wo warme feuchte Luft kondensiert (häufig in Zimmerecken oder hinter Schränken an Außenwänden). Infrarotwärme bestrahlt genau diese Flächen direkt und hält sie wärmer und trockener. Somit sinkt dort die relative Feuchte und es entsteht ein ungünstiges Milieu für Schimmelpilz. Wichtig ist dennoch korrektes Lüften, aber die Heizart selbst unterstützt ein trockenes, schimmelfreies Raumklima.
Gesundheitliche Unbedenklichkeit: Manche Anwender fragen sich, ob die Strahlung einer Infrarotheizung irgendwie schädlich sein könnte. Hier kann Entwarnung gegeben werden: Es handelt sich um langwellige Infrarot-C-Strahlung, die lediglich eine Wärmewirkung hat und nicht zu verwechseln ist mit UV-Strahlung oder Röntgenstrahlung. Die Oberflächentemperaturen der Paneele liegen meist bei 80–100 °C – heiß genug, um Wärme abzugeben, aber nicht so hoch, dass gefährliche Strahlungsemissionen auftreten. Die IR-Wellen dringen nur wenige Millimeter in die Haut ein und erwärmen hauptsächlich die Hautoberfläche – das ist völlig normal und unkritisch (vergleichbar dem Aufenthalt in warmem Sand oder vor einem Kaminfeuer). Auch für die Augen besteht bei normaler Nutzung keine Gefahr. Man sollte natürlich nicht minutenlang aus nächster Nähe ununterbrochen in ein hell glühendes Infrarot-Heizelement starren – aber Infrarot-Flächenheizungen glühen ohnehin nicht sichtbar wie z.B. Heizstrahler, sondern geben unsichtbare Wärmestrahlung ab. Insgesamt gilt die Strahlungswärme dieser Heizungen als gesund und gut verträglich. Einige Nutzer schätzen sie sogar aus therapeutischen Gründen (Wärme kann Verspannungen lösen). Es gibt keine spezifischen gesundheitsschädlichen Emissionen, und da keine Verbrennung stattfindet, entstehen auch keine Abgase im Raum (anders als etwa bei Gasöfen oder Kaminöfen, wo Abgasspuren oder Feinstaub entstehen können).
Sicherheitshinweise: Im gesundheitlichen Kontext sei erwähnt, dass die Oberflächen der Paneele heiß werden. Direktes Berühren kann zu Verbrennungen führen. Vor allem in Haushalten mit kleinen Kindern sollte man darauf achten, dass Heizplatten an der Decke oder höher an der Wand montiert sind oder einen gewissen Schutz haben. Einige Modelle für Kinderzimmer oder Badezimmer verfügen über Oberflächenschutzgitter oder Temperaturbegrenzer. Bei sachgerechter Installation besteht aber keine erhöhte Unfallgefahr. Positiv zu vermerken: Es gibt keine offenen Flammen, keine Verbrennungsgefahr durch Gas und auch kein Risiko durch austretendes Kohlenmonoxid, was die Infrarotheizung zu einer sehr sicheren Heizmethode macht.
Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit
Strommix und CO₂-Bilanz: Ob Infrarotheizungen umweltfreundlich sind, hängt maßgeblich von der Herkunft des Stroms ab. Da es sich um elektrische Direktheizungen handelt, ist ihre CO₂-Bilanz direkt mit dem Strommix verbunden. In Deutschland stammen aktuell etwa 40–50 % des Stroms aus erneuerbaren Energien; der Rest kommt aus fossilen Quellen (Kohle, Gas) und Atomkraft. Wird eine Infrarotheizung mit konventionellem Netzstrom betrieben, verursacht sie – indirekt über die Kraftwerke – durchaus beachtliche CO₂-Emissionen, oft mehr als eine effiziente Gasheizung es täte. Denn die verstromten fossilen Energien haben Umwandlungsverluste im Kraftwerk, die dem Endverbraucher nicht sichtbar sind. Beispiel: 10.000 kWh Heizwärme über Infrarot aus deutschem Netzstrom könnten im Kraftwerksmix mehrere Tonnen CO₂ verursachen, während 10.000 kWh aus Erdgas vor Ort etwa 2 Tonnen CO₂ erzeugen würden. Deshalb gelten Elektroheizungen im Allgemeinen nur dann als klimafreundlich, wenn sie mit Ökostrom betrieben werden. Wer einen echten Ökostrom-Tarif wählt oder eine eigene Photovoltaikanlage hat, kann den CO₂-Ausstoß drastisch senken. Mit 100 % regenerative Energie wäre die Infrarotheizung im Betrieb nahezu CO₂-neutral.
Erneuerbare Energien und Kombinationen: Infrarotheizungen lassen sich gut mit Photovoltaik-Anlagen kombinieren. Hausbesitzer mit Solarstrom können tagsüber eigenen Strom zum Heizen verwenden und so Netzstrombezug reduzieren. Allerdings scheint die Sonne vor allem mittags – in kalten Winternächten hingegen muss man doch meist Netzstrom ziehen. Speicherlösungen (Batterien) oder zeitversetztes Heizen (Vorheizen am Nachmittag) können hier helfen. Im Optimalfall wird ein Niedrigenergiehaus tagsüber durch die Sonne aufgeheizt (passiv und aktiv per PV-Strom in IR-Heizungen) und kühlt nachts nur wenig aus. Langfristig könnte eine breite Nutzung von Stromheizungen den Ausbau erneuerbarer Energien fördern, da eine höhere Stromnachfrage an kalten Tagen zusätzliche regenerative Kraftwerkskapazität erfordert – das ist jedoch ein gesamtwirtschaftlicher Aspekt. Für den Einzelnen zählt: Ohne Ökostrom sind IR-Heizungen ökologisch nachteilig, mit Ökostrom jedoch sauber.
Kein Feinstaub, keine direkten Emissionen: Im Gegensatz zu Holz- oder Pelletöfen entstehen bei Infrarotheizungen keinerlei Feinstaub oder Rauchgase. Dies verbessert die lokale Luftqualität und reduziert Gesundheitsrisiken durch Schadstoffe. Auch im Vergleich zu Ölheizungen oder Gasheizungen vermeidet man jede Art von Geruch, Abgas oder Kondensat. Aus Umweltsicht ist positiv, dass kein fossiler Brennstoff im Haus gelagert oder verbrannt wird. Es gibt auch keine Wärmeverluste durch lange Transportwege (etwa Fernwärmeverluste) – die Energie wird direkt im Raum genutzt. Zudem entfallen Ressourcen für Rohstoffförderung und Transport, sofern der Strom regenerativ erzeugt wird.
Nachhaltigkeit und Herstellungsaspekte: Infrarotheizungen bestehen aus Metall, Glas oder Keramik und heizleitenden Folien – sie sind relativ langlebig und wartungsfrei. Der Ressourcenverbrauch zur Herstellung ist geringer als der einer komplexen Zentralheizung (es braucht z.B. keine Kupferrohre, keine Pumpen oder Chemikalien für Wärmetauscher). Das entspannt die Ökobilanz in der Produktions- und Entsorgungsphase etwas. Allerdings darf man nicht vergessen, dass der Haupt-Nachhaltigkeitsfaktor der Energieverbrauch im Betrieb ist: Über viele Jahre kann ein ineffizientes Heizsystem den Vorteil geringer Herstellungsenergie zunichtemachen. Daher ist die allgemeine Expertenmeinung: Infrarotheizungen sind nur dann nachhaltig, wenn der Strom dafür grün ist und wenn das Gebäude wenig Heizenergie benötigt. In einigen deutschen Bundesländern werden Elektro-Direktheizungen in Neubauten deshalb nicht als alleinige Heizung anerkannt (weil sie sonst gegen Effizienzvorschriften verstoßen würden). In der Schweiz ist es teils sogar verboten, Neubauten ausschließlich mit Stromdirektheizungen zu versehen – hier will man sicherstellen, dass effiziente Heiztechnik (z.B. Wärmepumpen) genutzt wird, um den gesamtgesellschaftlichen Stromverbrauch zu begrenzen. Diese Regulierungen verdeutlichen: Unter heutigen Bedingungen sind Infrarotheizungen aus Umwelt- und Energiesparsicht Nischenlösungen, die gezielt eingesetzt sinnvoll sein können, aber fossile Systeme noch nicht flächendeckend ersetzen sollen.
Entsorgung und End-of-Life: Am Ende der Lebensdauer lässt sich ein Infrarotpaneel relativ unkompliziert recyceln oder entsorgen – es enthält vorrangig Metalle (Aluminiumrahmen, Kupferleitungen) und mineralische Stoffe. Keine besonderen umweltgefährdenden Inhaltsstoffe wie bei manchen Nachtspeicheröfen (früher Asbest) oder Kühlmittel wie in Wärmepumpen. Das Thema Umweltfreundlichkeit ist also primär an den Energiehunger gekoppelt: Ist genügend Ökostrom verfügbar, sind IR-Heizungen grüner Wärmekomfort; ist der Strom fossile Erzeugung, verschiebt man Emissionen nur vom Haus in das Kraftwerk.

Zielgruppenanalyse: In welchen Fällen ist eine Infrarotheizung sinnvoll?
Nachdem Effizienz, Kosten, Gesundheit und Ökologie betrachtet sind, stellt sich die Frage, wer am ehesten von Infrarotheizungen profitiert. Hier unterscheiden sich die Anforderungen von Alt- und Neubauten, Mietern und Eigentümern sowie der Nutzungsart der Räume deutlich.
Altbau: Eignung und Herausforderungen
In Altbauten – insbesondere solchen, die schlecht gedämmt sind – stößt die Infrarotheizung als Hauptheizung an Grenzen. Die Heizlast ist in älteren Gebäuden meist hoch (durch dünne Wände, undichte Fenster, hohe Decken), sodass viele IR-Paneele mit hohem Stromverbrauch nötig wären, um behaglich warm zu bekommen. Wirtschaftlich und ökologisch wäre das kaum vertretbar, da der Strombedarf immens wäre. Zusätzlich können in sehr alten Häusern die elektrischen Leitungen zum Problem werden: Nicht jedes Altbau-Stromnetz verkraftet den gleichzeitigen Betrieb mehrerer 1-2-kW-Paneele, ohne dass Sicherungen auslösen. Lohnt es sich gar nicht im Altbau? – Als alleiniges Heizsystem meist nicht, solange keine umfassende Sanierung erfolgt ist. Allerdings gibt es sinnvolle Nischen: Infrarotheizungen können in Altbauten punktuell als Zusatzheizung dienen. Beispielsweise kann ein IR-Heizpaneel im feuchten Kellerraum oder Bad eines Altbaus helfen, Schimmel vorzubeugen und bei Bedarf schnell Wärme zu liefern, ohne die ganze Heizungsanlage hochzufahren. Auch einzelne kalte Ecken oder Zimmer (ein selten genutztes Gästezimmer etwa) lassen sich mit einem elektrischen Paneel flexibel beheizen, falls die vorhandene Heizung dort nicht ausreicht oder nicht ständig betrieben werden soll. So gesehen können Altbaubesitzer von IR-Heizungen profitieren, ergänzend zur Hauptheizung, um den Komfort zu steigern oder gezielt Problemstellen zu beheizen. In aufwendig renovierten Altbauten mit Wärmedämmung kann man theoretisch auf IR als Hauptheizung setzen – doch hier gelten dann quasi die gleichen Bedingungen wie im Neubau (niedrige Heizlast). Unterm Strich bleibt: Im klassischen unsanierten Altbau überwiegen die Nachteile – der hohe Verbrauch und die Kosten – sodass Infrarotheizungen dort eher ein ergänzendes Hilfsmittel statt einer Alternative zum zentralen Heizen sind.
Neubau: Vorteile oder Nachteile gegenüber anderen Heizsystemen
Moderne Neubauten sind oft sehr gut gedämmt und haben einen geringen Heizenergiebedarf (Stichwort KfW-Effizienzhaus, Passivhaus). Das eröffnet tatsächlich ein Einsatzfeld für Infrarotheizungen als Alternative zur Zentralheizung. Die Vorteile im Neubau: Es fallen keine Kosten für Heizungsraum, Verrohrung oder Schornstein an. Die Baukosten können sinken, wenn man statt einer Fußbodenheizung mit Wärmepumpe einfach in jedem Raum ein paar Infrarotpaneele installiert. Die Installation ist simpel und wartungsfrei, was dem Bauherren zunächst Geld spart. Außerdem kann ein Neubau mit Photovoltaik gleich so ausgelegt werden, dass ein Teil des Heizstroms selbst erzeugt wird. Flexibilität ist ein weiterer Punkt: Mit IR-Paneelen lässt sich jeder Raum individuell steuern, was z.B. in einem modernen Smart Home Konzept integrierbar ist.
Allerdings gibt es auch Nachteile zu bedenken: Die aktuelle Gesetzeslage (Gebäudeenergiegesetz in Deutschland) bewertet elektrische Direktheizungen mit einem ungünstigen Primärenergiefaktor. Das bedeutet, es ist schwierig, mit einer reinen Stromheizung die erforderlichen Effizienzstandards einzuhalten, ohne kräftig mit Photovoltaik, Lüftungswärmerückgewinnung o.ä. zu kompensieren. In manchen Bundesländern wird eine reine Infrarotheizung daher nicht anerkannt als alleiniges Heizsystem für den Neubau, und es gibt – anders als für Wärmepumpen oder Solarthermie – keine Förderprogramme dafür. Rein praktisch ist ein weiterer Nachteil im Neubau, dass man auf Warmwasser nicht vergessen darf: Infrarotheizungen liefern nur Raumwärme, kein Warmwasser für Bad und Küche. Man bräuchte also separate Durchlauferhitzer oder Boiler, was wiederum den Strombedarf erhöht. Oft werden in strombeheizten Häusern dann sowohl IR-Paneele für die Zimmer als auch Elektrodurchlauferhitzer für Wasser verwendet – das kann die elektrische Anschlussleistung des Hauses stark in die Höhe treiben (Netzanschlusskosten).
Fazit für Neubau: Für sehr energieeffiziente kleine Gebäude kann eine Infrarotheizung eine kostengünstige und technisch einfache Lösung sein, besonders wenn man Wert auf geringe Investitionskosten legt und vielleicht selbst Strom erzeugt. Die Behaglichkeit ist dabei gegeben, solange das Haus gut gedämmt ist (man hat ja kaum Wärmeverluste). Aber man muss sich bewusst sein, dass man sich auf Jahrzehnte an den Strom als Energieträger bindet – mit allen Preisrisiken – und dass man die höheren Betriebskosten in Kauf nimmt. Viele Neubau-Besitzer wägen daher genau ab: Niedrige Baukosten jetzt gegen möglicherweise höhere laufende Kosten später. In der Regel werden Infrarotheizungen im Neubau eher selten als Hauptheizung gewählt, außer in Spezialfällen (etwa ein Ferienhaus, Tiny House, Passivhaus ohne klassischen Heizbedarf). Oft findet man IR-Heizelemente im Neubau hingegen als Zusatz: zum Beispiel ein Infrarot-Spiegelheizkörper im Bad für extra Wärme beim Duschen, obwohl das Haus ansonsten z.B. mit Wärmepumpe beheizt wird. Diese Kombinationen vereinen dann Effizienz und Komfort.
Wohnungen: Eignung für Mietwohnungen
In Wohnungen hängt der Einsatz stark davon ab, ob man Mieter oder Eigentümer ist und welche Heiz-Infrastruktur vorhanden ist. In den meisten Mietwohnungen gibt es eine vom Vermieter gestellte Hauptheizung (Zentralheizung fürs ganze Haus, Etagenheizung oder ähnliche Systeme). Hier kann der Mieter nicht einfach die Hauptheizung austauschen – eine Infrarotheizung käme dann allenfalls ergänzend zum Einsatz. Eine typische Situation: Die Wohnung wird zentral etwas unterversorgt (z.B. im Bad wird es mit der vorhandenen Heizung nicht richtig warm) – ein kleines IR-Paneel kann genau dann vom Mieter eingeschaltet werden, wenn er mehr Wärme möchte. Oder ein Mieter möchte seinen Verbrauch selbst steuern und dreht die Zentralheizung geringer, um stattdessen punktuell mit eigenem Strom zuzuheizen – etwa weil die Abrechnung der Zentralheizung ungünstig pauschal ist. Solche individuellen Lösungen sind aber immer mit dem Nachteil verbunden, dass der Mieter zusätzlich zum normalen Heizkostenanteil noch Strom zahlt. Wirtschaftlich ist das selten vorteilhaft, es sei denn, die zentrale Heizung ist extrem ineffizient oder teuer. In Eigentumswohnungen (Wohnungseigentum) kann der Besitzer eher entscheiden, das Heizsystem zu ändern – hier könnten Infrarotpaneele eine alte Nachtspeicherheizung ersetzen. In den 1970er-Jahren wurden viele Wohnungen mit elektrischen Nachtspeicheröfen ausgestattet; wenn diese ersetzt werden, sind moderne IR-Paneele eine mögliche Option, die effizienter und platzsparender ist. Man profitiert von moderner Steuerung und geringerem Gewicht (keine schweren Speichersteine mehr). Allerdings bleiben es elektrische Heizungen mit entsprechenden Stromkosten.
Für Mietwohnungen im speziellen: Ein Mieter darf in der Regel mobile oder leicht zu installierende Infrarotheizungen verwenden (z.B. ein Steckdosenmodell oder ein Paneel, das an zwei Schrauben an der Wand hängt), solange er keine baulichen Veränderungen vornimmt. Das ist ein Vorteil gegenüber etwa Gasöfen oder Holzöfen, die man als Mieter kaum genehmigt bekommt. Eine Infrarotheizung kann beim Auszug einfach wieder mitgenommen werden – das macht sie attraktiv für Leute, die keine dauerhafte Installation vornehmen dürfen. Außerdem benötigt man keine Genehmigung vom Vermieter, um einen elektrischen Heizkörper aufzustellen (ähnlich wie ein Heizlüfter oder Radiator). Allerdings muss die Elektroinstallation der Wohnung ausreichend dimensioniert sein, damit der Betrieb sicher ist (in einem alten Mietshaus mit nur 10-Ampere-Sicherungen könnte es problematisch werden, aber das ist selten). Wichtig zu wissen: In einer Mietwohnung, wo Heizkosten meist über Betriebskosten abgerechnet werden, zahlt man mit eigenem Strom für IR-Heizungen doppelt, wenn man die zentrale Heizung nicht entsprechend runterregelt – man würde also idealerweise die vorhandene Heizung weniger nutzen. Das setzt aber eine gewisse Regelungsmöglichkeit voraus (z.B. Thermostatventile zudrehen). Zudem sind die Entscheidungsfreiheit und Wirtschaftlichkeit limitiert: Der Mieter kann sich zwar für ein paar hundert Euro eigene Paneele kaufen, hat aber keinen Einfluss auf die Gebäudehülle oder den Hauptenergieträger. Daher eignet sich die Infrarotheizung in einer Mietwohnung vor allem für kurzzeitiges Beheizen einzelner Räume, in denen man extra Komfort möchte – etwa ein Hobbykeller oder das Arbeitszimmer, falls man tagsüber im Homeoffice sitzt und nicht die ganze Wohnung heizen will.
In reinen Elektro-Wohnungen (ohne Gasanschluss oder Zentralheizung) – dies kommt vor allem in älteren Häusern oder Ferienwohnungen vor – kann die Infrarotheizung eine modernere Alternative zu anderen elektrischen Heizgeräten sein. Gegenüber Heizlüftern ist sie leiser und angenehmer (kein Gebläse, kein Staubbrandgeruch), gegenüber Ölradiatoren oder Konvektoren liefert sie schnelleres Wärmegefühl. Für Vermieter kann es reizvoll sein, einfache wartungsfreie Heizpaneele in ihren Wohnungen zu installieren, anstatt eine teure Zentralheizung nachrüsten zu müssen. Allerdings gelten hier wieder die gesetzlichen Vorgaben: Einfach so eine Mietwohnung ausschließlich mit Strom heizen zu lassen, kann gegen heutige Effizienzstandards verstoßen, sofern es Neubauten oder sanierte Gebäude betrifft. In Bestandswohnungen ist es aber erlaubt, elektrisch zu heizen, solange der Mieter damit einverstanden ist (und die Stromkosten selbst trägt).
Hobbyräume und gelegentlich genutzte Räume
Für Hobbyräume, Gästezimmer, Gartenhäuser oder Werkstätten ist die Infrarotheizung nahezu prädestiniert. Diese Räume werden oft nicht kontinuierlich genutzt, sondern nur bei Bedarf. Ein klassisches Beispiel ist der Partykeller oder ein Hobbykeller: Es lohnt sich kaum, dafür die Hauptheizung permanent laufen zu lassen. Ein IR-Heizpaneel kann hier spontan zugeschaltet werden, wenn man den Raum nutzt, und sorgt binnen Minuten für spürbare Wärme an den Aufenthaltsplätzen. Ähnlich im Gartenhaus oder in der Garage: Bei einem gelegentlichen Aufenthalt im Winter schaltet man eine Decken-Infrarotheizung ein und wird direkt erwärmt, ohne dass man die ganze Umgebungsluft aufheizen muss (die ohnehin schnell wieder abkühlt, wenn es z.B. zugig ist). Die Praktikabilität ist hoch, weil man kein Heizsystem installieren muss – eine Steckdose reicht. Zudem besteht keine Frostgefahr: Wenn das Gartenhaus unbeheizt steht, kann nichts einfrieren (anders als bei einer wasserführenden Heizung, wo Leitungen platzen könnten).
Gelegentlich genutzte Räume wie Gästezimmer lassen sich mit IR-Technik komfortabel ausstatten, ohne sie ständig zu temperieren. Wenn Besuch kommt, macht man das Panel an und erreicht schnell eine angenehme Wärme, auch wenn das Zimmer vorher kühl war. Für Wintergärten/Wohnwintergärten sind Infrarot-Heizelemente ebenfalls beliebt, denn dort sind oft hohe Fensterflächen, an denen normale Heizkörper ineffizient wären. IR-Strahler können gezielt die Sitzbereiche wärmen, selbst wenn rundum viel Glas ist. Allerdings muss man beachten, dass in sehr offenen oder nach außen ungedämmten Räumen (etwa ein Carport oder eine offene Terrasse) die Wärme schnell verpufft – dort helfen nur leistungsstarke Hellstrahler für den Außenbereich, die aber hohe Wattzahlen haben. Für einen geschlossenen Hobbyraum jedoch ist ein elektrischer Heizstrahler eine einfache und wirkungsvolle Lösung.
Zusammengefasst sind punktuell genutzte Bereiche die Stärke von Infrarotheizungen: Man spart sich komplexe Heizungsinstallationen und heizt genau dann, wenn wirklich jemand anwesend ist. In solchen Fällen fallen die Betriebskosten kaum ins Gewicht, weil die Nutzungsdauer begrenzt ist, während die Anschaffungskosten sehr niedrig sind. Somit sind Hobbykeller, Werkstätten, Garagen, Gartenlauben, Gästezimmer oder auch Badezimmer typische Einsatzorte, an denen Infrarotheizungen als Alternative (oder Ergänzung) glänzen.
Eigentümer vs. Mieter: Wirtschaftlichkeit und Entscheidungsfreiheit
Die Frage, ob eine Infrarotheizung passt, hängt auch davon ab, ob man frei über die Heizungsanlage entscheiden kann (Eigentümer) oder nicht (Mieter). Eigentümer eines Hauses haben die volle Entscheidungsfreiheit, müssen aber die Wirtschaftlichkeit über die Lebensdauer im Blick behalten. Hier gilt: Eine Infrarotheizung als Hauptsystem ist vor allem dann wirtschaftlich, wenn die laufenden Kosten niedrig gehalten werden können – also idealerweise mit eigenem Solarstrom oder zumindest mit dem Bewusstsein, dass man höhere Stromrechnungen zahlt. Ein Hausbesitzer kann z.B. kalkulieren, dass er statt 20.000 € für eine Wärmepumpe nur 3.000 € für IR-Paneele ausgibt und die Differenz in eine PV-Anlage investiert. Über Jahre hinweg kann sich das lohnen, insbesondere wenn Wartungskosten niedrig bleiben und keine Reparaturen anfallen. Eigentümer können auch hybride Konzepte fahren, etwa für Übergangszeiten IR-Heizung und für Spitzenlast einen Kaminofen oder eine kleine Gasheizung – sowas erfordert natürlich genaue Planung, ist aber machbar.
Mieter hingegen sind meistens an das vorhandene System gebunden. Ihre Entscheidungsfreiheit beschränkt sich auf portable oder leicht rückbaubare Geräte. Die Wirtschaftlichkeit für Mieter ist oft schwieriger, da sie doppelt zahlen würden, wenn sie eine eigene Heizung nutzen: Einmal indirekt an den Vermieter (über Nebenkosten/Vorauszahlungen für die Hauptheizung, sofern vorhanden) und dann noch den eigenen Strom. Ein Mieter kann kaum vom Vermieter verlangen, die Zentralheizung abzuschalten, nur weil er mit eigenem Strom heizen möchte – das wäre kontraproduktiv. Realistisch setzen Mieter IR-Heizungen nur gezielt ein, wo es für sie Komfort bringt und überschaubare Kosten verursacht (z.B. ein kleines Panel im Bad, was vielleicht 10€ mehr Stromkosten im Monat bedeutet, dafür aber deutlich mehr Komfort). Die Entscheidungsfreiheit des Mieters ist also eingeschränkt, und die Infrarotheizung wird für ihn eher eine Ergänzung oder Zwischenlösung sein.
Anders sieht es aus, wenn ein Mieter in einer Wohnung lebt, die ohnehin keine andere Heizung hat (z.B. Ofenheizung rausgenommen, aber keine Zentralheizung eingebaut). Dann könnte er mit Erlaubnis des Vermieters Infrarotpaneele installieren, um eine feste elektrische Heizung zu haben. Die Kosten trägt er dann selbst. Hier hat der Mieter – im Rahmen der gegebenen Wohnsituation – die Freiheit zu entscheiden, welches elektrische System er nutzt (Infrarotpaneel vs. Elektro-Konvektor). Er muss aber mit dem Vermieter klären, ob dieser eventuell für einen Teil der Heizkosten aufkommt oder die Miete anpasst, je nachdem wie die vertragliche Regelung ist.
Eigentumswohnungen: Besitzer einer Eigentumswohnung können innerhalb ihres Apartments IR-Heizungen montieren, sofern das Haus keinen gemeinsamen Heizungsverbund hat (in vielen Wohnanlagen gibt es aber eine Zentralheizung für alle, die man nicht so einfach stilllegen kann). In einer Wohnung ohne Zentralheizung entscheidet dann der Eigentümer eigenverantwortlich über die Heizart. Hier spielen ähnliche Überlegungen wie beim Einfamilienhaus eine Rolle, aber die Skalierung ist kleiner – eine 60 m² Wohnung ließe sich mit 4–5 IR-Paneelen beheizen, Anschaffung vielleicht 2000 €, was erheblich weniger ist als z.B. eine eigene Therme installieren zu lassen. Doch auch hier muss der Eigentümer die Energiekosten selbst tragen, ohne Förderungen.
Langfristige Aspekte: Für Eigentümer ist noch wichtig, dass das Gebäude einen Energieausweis bekommt. Ein Haus, das nur mit elektrischer Direktheizung ausgestattet ist, erhält einen recht schlechten Kennwert (hoher Primärenergiebedarf). Das kann den Immobilienwert oder die Vermietbarkeit mindern, da zukünftige Käufer oder Mieter hohe Kosten erwarten. Ein Eigentümer muss diese Auswirkungen bedenken. Ein Mieter hingegen denkt eher kurzfristig an seine monatlichen Kosten und Komfort. Er kann notfalls ausziehen, wenn es zu teuer wird, während der Eigentümer in sein Gebäude investiert hat. Daher sind Eigentümer oft vorsichtiger, ihr Haus komplett auf Stromheizung zu setzen, es sei denn, sie haben einen robusten Plan mit erneuerbarer Energie.
Zusammengefasst: Eigentümer haben mehr Handlungsspielraum, Infrarotheizungen als Alternative in Betracht zu ziehen – sie können alle Faktoren (Dämmung, PV-Anlage, Ergänzungsheizung) beeinflussen und langfristig rechnen. Für Mieter sind IR-Heizungen meist nur ergänzende Komfortlösungen im begrenzten Rahmen, da sie weder die Bausubstanz ändern können noch die primäre Heizquelle frei wählen, und wirtschaftlich selten günstiger fahren als mit der vom Vermieter gestellten Heizung.
Fazit
Infrarotheizungen stellen eine interessante Heizalternative dar, die vor allem durch einfache Installation, direkte Strahlungswärme und geringen Wartungsaufwand überzeugt. Effizient eingesetzt werden sie dort, wo sie bedarfsgerecht einzelne Bereiche wärmen und kein hoher Dauer-Wärmeverbrauch entsteht – etwa in gut gedämmten Räumen oder bei sporadischer Nutzung. In punkto Kosten sind sie unschlagbar günstig in der Anschaffung und verursachen keine Wartungskosten, wohingegen die Strombetriebskosten bei Dauerheizung höher liegen als bei vielen klassischen Systemen. Aus gesundheitlicher Sicht bieten Infrarotheizungen ein angenehmes, allergikerfreundliches Raumklima ohne Staub und Schimmel, was dem Wohlbefinden zugutekommt. Umweltfreundlich können sie sein, wenn sie mit erneuerbarem Strom betrieben werden, doch bei konventionellem Strommix schneiden sie energetisch schlechter ab als z.B. Wärmepumpen oder Holzheizungen. Die Zielgruppenanalyse zeigt: Altbau-Bewohner sollten IR-Paneele vor allem als Zusatzheizung sehen, Neubau-Hausherren können unter bestimmten Voraussetzungen damit ein minimalistisches Heizkonzept umsetzen, Mieter nutzen sie meist nur punktuell für mehr Komfort, und Hobbyraum-/Nebenraum-Nutzer profitieren am deutlichsten von der schnellen, flexiblen Wärme. Schließlich müssen Eigentümer langfristig Kosten und Nutzen abwägen, während Mieter eher kurzfristig ihre individuelle Behaglichkeit verbessern können.
Abschließend lässt sich sagen, dass Infrarotheizungen eine sinnvolle Alternative für bestimmte Anwendungen und Zielgruppen darstellen – insbesondere dort, wo klassische Heizsysteme unwirtschaftlich oder unpraktisch wären. Sie ersetzen jedoch nicht für jeden Fall die etablierten Heizungen. Wer mit dem Gedanken spielt, auf Infrarot umzusteigen, sollte die Rahmenbedingungen genau prüfen: Dämmstandard, Raumgrößen, Strompreise und Nutzungsverhalten. Unter passenden Bedingungen können Infrarotheizungen dann ihre Vorteile voll ausspielen und zu einer komfortablen, sauberen Heizlösung werden.